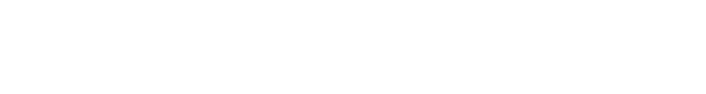Infrastruktur gewährleisten
Von wem Infrastrukturen wie bereitgestellt werden und in welche gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen dies eingebettet ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Seit den 1980er Jahren wurden staatliche Leistungen „liberalisiert“, (teil-)privatisiert und neuen Modellen der Wettbewerbssteuerung unterworfen. Orientiert hat man sich dabei am Leitbild des „Gewährleistungsstaates“. Gemäß diesem Leitbild soll der Staat die allgemeine Versorgung und Qualität der Infrastrukturdienstleistungen nicht selbst erbringen, sondern dadurch sicherstellen, dass er deren Bereitstellung und Nutzung überwacht und durch Auflagen und Mindeststandards reguliert. In der Umsetzung dieses Leitbildes wurde das Zusammenspiel zwischen staatlichen und privaten Akteuren neu ausgehandelt. Außerdem wurden die rechtlichen Kompetenzen und die politische Verantwortung verändert. Auch Fragen des Gemeinwohls und Erwartungen an die staatliche Gewährleistung wurden im öffentlichen Diskurs neu ausgehandelt.
Infrastrukturdienstleistungen repräsentieren wichtige sachliche Komponenten des Gemeinwohls. Sie stellen insofern öffentliche Güter dar, als bei ihnen keine rivalisierende Nutzung bestehen und von ihnen niemand ausgeschlossen werden soll. Diese Anforderungen an die öffentliche Infrastruktur steht allerdings in einem doppelten Spannungsverhältnis: a) zur wettbewerbs- oder marktförmigen Regulierung und den Effizienz- und Profiterwartungen privater Unternehmen; und b) zu den begrenzten Ressourcen und den Handlungslogiken staatlicher Akteure. Dieses Spannungsverhältnis tritt vor allem dann hervor, wenn die infrastrukturelle Versorgung und Leistungserbringung als defizitär erscheinen.
Aktuelle Blogbeiträge
„Daten sind Waffen in meiner Hand“
Wer sich mit der Autoindustrie, der Ölindustrie, der Flugzeugindustrie, der Schifffahrtsindustrie und mit der Agrarindustrie anlegt, der braucht ein sehr dickes Fell. Wie viel Kampfgeist in solch einer Peron stecken muss, zeigt das Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter des Umweltministeriums. Die Autoindustrie wie auch das Umweltministerium hätten versucht ihn los zu werden, doch wer ihn angreife müsse wissen, was er macht.
Zwischen Klagen und Grenzwerten
Das dritte Policy-Paper untersucht vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Luftverschmutzung in vielen deutschen Städten, wie die lokale Ebene auf das Problem reagiert. Zentral ist dabei die Frage, wie mit Emissionen des motorisierten Individualverkehrs, wie Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon, umgegangen wird. Dies ist eine wichtige Stellschraube für die Luftreinhaltung in Städten.
Das Forschungsprojekt
Das Forschungsprojekt „Gemeinwohl-relevante öffentliche Güter – die politische Organisation von Infrastrukturaufgaben im Gewährleistungsstaat“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in der Förderline „Teilhabe und Gemeinwohl“ finanziert und ist am Institut für Politikwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen angesiedelt.
Wir untersuchen, wie Infrastrukturaufgaben als öffentliche Güter politisch konzipiert und gegenüber dem Gewährleistungsstaat eingefordert werden. Uns interessiert, in welchem Maße sich der Staat in der Organisation gemeinwohlorientierter Leistungen als Gewährleistungsstaat begreift und den an ihn gerichteten Erwartungen zu entsprechen vermag. Unser Blick richtet sich auf ausgewählte Handlungsfelder:
- die ambulante Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum
- die Bereitstellung von städtischem Wohnraum
- die Sicherstellung von „sauberer Luft“.
In diesen Handlungsfeldern wollen wir genauer bestimmen, welche spezifischen Entwicklungen, Probleme und Hindernisse es gibt und wie hierauf seitens der politischen VerantwortungsträgerInnen reagiert wird. Wir analysieren dabei insbesondere die konkurrierenden Bedeutungen und Rechtfertigungen für das staatliche Angebot öffentlicher Güter. Zudem wird untersucht, welche Gewährleistungsansprüche zivilgesellschaftliche Akteure an den Staat herantragen. Unter den konkurrierenden diskursiven und programmatischen Vorstellungen sollen – unter dem Aspekt der Teilhabe – die Positionen sog. „schwacher Interessengruppen“ besondere Beachtung finden.
Forschungsprozess und Forschungsergebnisse
Im Forschungsprojekt treten wir auf unterschiedliche Weise mit beteiligten Akteuren in Austausch: a) zum einen als wichtige ImpulsgeberInnen für eine Präzisierung der Fragestellungen; b) als RatgeberInnen bei der Erschließung des empirischen Feldes; und c) als NutzerInnen der Forschungsergebnisse. Der Forschungsprozess ist mithin interaktiv angelegt. In verschiedenen Kontexten werden Teilergebnisse der Untersuchung einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung und zur Diskussion gestellt: auf dieser Website (Aktuelles, Materialien, Blog), im Rahmen themenzentrierter Workshops, durch Fachtagungen, fachwissenschaftliche und allgemeine Veröffentlichungen sowie Materialien für die schulische und außerschulische Bildung.
Bildquelle: Comet Trail Hamburg Wilhelmsburg (c) Rasande Tyskar

„Daten sind Waffen in meiner Hand“
Wer sich mit der Autoindustrie, der Ölindustrie, der Flugzeugindustrie, der Schifffahrtsindustrie und mit der Agrarindustrie anlegt, der braucht ein sehr dickes Fell. Wie viel Kampfgeist in solch einer Peron stecken muss, zeigt das Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter des Umweltministeriums. Die Autoindustrie wie auch das Umweltministerium hätten versucht ihn los zu werden, doch wer ihn angreife müsse wissen, was er macht.

Zwischen Klagen und Grenzwerten
Das dritte Policy-Paper untersucht vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Luftverschmutzung in vielen deutschen Städten, wie die lokale Ebene auf das Problem reagiert. Zentral ist dabei die Frage, wie mit Emissionen des motorisierten Individualverkehrs, wie Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon, umgegangen wird. Dies ist eine wichtige Stellschraube für die Luftreinhaltung in Städten.

Öffentliche Infrastrukturen als politisches Thema der kommenden Gesellschaft – Überlegungen zur Infrastrukturpolitik und Anregungen für die Praxis der Politischen Bildung“
Wie gestaltet sich das Verhältnis von Öffentlichen Gütern und Infrastruktur? Was gewährleistet der Staat und wie hat sich dessen Rolle in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt? Welche Rolle spielen dabei verschiedene gesellschaftliche Vorstellungen darüber, was Gemeinwohl überhaupt bedeuten soll? Über vier Jahre hinweg beschäftigte sich unser Forschungsprojekt „Gemeinwohlrelevante Öffentliche Güter“ mit diesen Fragen und untersuchte dafür die Politikfelder „ärztliche Gesundheitsversorgung auf dem Land“, „bezahlbarer Wohnraum in Städten“ sowie „saubere Luft“.

„Gerade an der Mobilität scheiden sich die Geister“
Technische Innovationen und Wirtschaftlichkeit sind in Deutschland eng verzahnt. Doch wie verhält sich dieses Duo in der Debatte um sauberer Luft und Luftqualität in deutschen Städten? In einem Interview eröffnet ein Mitarbeiter eines global agierenden, deutschen Technologieunternehmens seine Perspektive auf technischen Innovationsgeist und einer lebenswerteren Umgebung mit sauberer Luft.

„Planung nicht nur top-down, sondern auch bottom-up“
Das Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen ist ein Verein mit unterschiedlichen Teilorganisationen: eine Beratungsstelle für gemeinschaftliche Wohnprojekte in Frankfurt, die Genossenschaftliche Immobilienagentur (Gima), die sozialverträgliche Hausverkäufe an Genossenschaften organisiert, und eine auf hessischer Ebene angesiedelte Landesberatungsstelle.
Wie andere Akteure des gemeinschaftlichen Wohnens ist auch das Netzwerk Frankfurt ein wichtiger Impulsgeber für Architektur, Städtebau, Bodenpolitik und partizipative Stadtplanung. Wie hat sich dieses Marktsegment in Frankfurt entwickeln und festigen können?

„Infrastrukurlos, nahezu“. Ein Interview RomaRespekt
Die Dresdner Initiative RomaRespekt ist Teil der BettelLobby und setzt sich für ein Recht auf Wohnung und gegen Rassismus ein. Das Interview handelt von Ausschlüssen aus dem Wohnungsmarkt, von den politischen Forderungen der Initiative, ihren politischen Strategien, vom Verhältnis zur Stadtverwaltung und zu Vonovia SE.